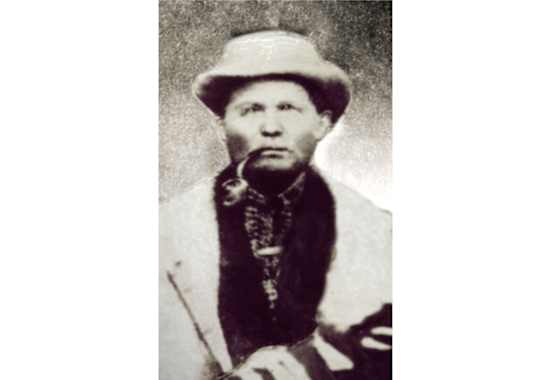Sicher auf Hochtour: Anseilen am Gletscher
Foto: argonaut.pro
von Peter Plattner
Die Sicherheitsexperten Peter Plattner und Walter Würtl zeigen, wie man sich auf der Skihochtour am Gletscher richtig anseilt.
Hat sich eine Gruppe entschieden, sich beim Begehen eines Gletschers anzuseilen, was meistens eine gute Idee ist, dann hängt es von der Grösse der Seilschaft, dem Können, dem vorhandenen Material und den aktuellen Verhältnissen ab, wie man sich am besten mit dem Seil verbindet. Es gibt zwar allgemeine, gültige Grundlagen, die Entscheidung über die gewählte Anseilart hängt aber zum Beispiel davon ab, ob man nur zu Zweit unterwegs ist und sich beide selbstständig aus einer Spalte herausprusiken können oder in einem Sechserteam, bei dem die Hälfte wenig Ahnung von Rettungsmethoden hat. Bevor wir uns die Seiltechniken im Detail ansehen, stellen wir euch erst einmal die Grundlage zum korrekten Anseilen am Gletscher vor.
Anseiltechnik
In Österreich und Deutschland wird am Gletscher traditionellerweise mittels Karabiner und Achterknoten angeseilt. Hierfür werden selbsttätige 3-Weg-Verschlusskarabiner (Safe-Lock- oder Safer-Karabiner) empfohlen. Der Seilschaftserste und -letzte kann sich auch direkt mittels Achterknoten ins Seil einbinden.

In der Schweiz hingegen wird gerne das direkte Anseilen aller Seilschaftsmitglieder in den Sitzgurt mittels eines gesteckten Sackstichs (dort auch „Führerknoten“ genannt) praktiziert. Eine gute Sache, die auch in anderen Ländern immer beliebter wird, spart man doch Material und ist direkt mit dem Seil verbunden. Einzig bei der Rettungstechnik muss man dann kleine Anpassungen vornehmen, weil man sich beispielsweise nicht von einem gespannten Seil aushängen kann.

Ebenso aus der Schweiz stammt die sehr empfehlenswerte Idee, eine lange Bandschlinge (oder Reepschnur) mittels Ankerstich am Hüftgurt zu montieren. Diese wird dann über der Schulter getragen und mit einem Karabiner am Rucksack befestigt: Damit kann man bei einem Spaltensturz sofort den Rucksack „abwerfen“, der sonst nach hinten zieht und die Bauchmuskeln strapaziert. Der Hauptvorteil: Auch wenn man unangeseilt am Gletscher unterwegs ist – was immer wieder vorkommen kann – und in eine Spalte stürzt, kann in diese Schlinge „von oben“ sofort ein Seil eingehängt werden – schon ist ein weiteres Abrutschen verhindert und man kann am Seil herausgezogen werden. Für dieses System hat sich der Name Abwurf- oder Schweizer-Schlinge eingebürgert. Schaut man sich die Unfallzahlen an, dann sind es nicht (nur) tiefe Stürze, sondern oft Stürze in sich verengende Spalten, in denen man stecken bleibt. Kann man jetzt nicht schnell herausgezogen werden – weil angeseilt oder eben mit der Schweizer Schlinge von oben schnell fixierbar –, dann schmilzt man durch die Körperwärme immer stärker in das umgebende Eis ein, was fatale Folgen haben kann.

Abstände
Die Abstände in einer Gletscherseilschaft betragen in der Regel mindestens (!):
14-18 m bei einer Zweierseilschaft,
10-12 m bei einer Dreierseilschaft,
8-10 m bei Seilschaften mit vier oder mehr Personen.
Aufgrund der drohenden Mitreißgefahr ist eine Zweierseilschaft am Ungünstigsten. Mit Seilschaften von mehr als fünf Personen ist man hier sehr sicher, allerdings sind nur noch recht einfache Gletscheranstiege machbar. Muss man komplexe Anstiege – Seraczone, viele Richtungsänderungen, … – in einer grossen Seilschaft bewältigen, sind kürzere Abstände meist hilfreich. Prinzipiell gilt: Je gefährlicher der Gle
Bremsknoten
Bei Seilschaften aus zwei oder drei Personen sind auch Bremsknoten eine gute Idee: Jeweils von der Mitte ausgehend werden im Abstand von circa 2 Metern drei Knoten in das Seil zwischen den Tourengehern gemacht. Die Idee: Stürzt eine Person in eine Spalte und das gespannte Seil schneidet sich in den Spaltenrand ein, können diese Bremsknoten den Sturz stoppen bzw. ein Halten erleichtern. Diese Knoten sollen also möglichst groß sein, damit sie sie das eingeschnittene Seil gut halten oder zumindest die Bremswirkung erhöhen – nur benötigen solche große Knoten wieder mehr Seil und wenn die Seillänge ohnehin schon knapp bemessen ist …. Ein bewährter Kompromiss ist eine Achter- oder Sackstichschlinge, ideal ein sog. BFK („Big Fat Knot“, frei nach unseren Freunden von Picos-Guiodes). Und Nein! Niemand muss hier einen eigenen Knoten wie z.B. den Schmetterlingsknoten lernen. Diese Bremsknoten können bei manchen Rettungstechniken zwar lästig sein, ein richtiges Problem stellen sie allerdings nicht dar. Wenn man die passende Seiltechnik geübt hat.
Restseil
Je nach Gruppengröße und Seillänge kann ein Seilrest übrig bleiben. Dieses Restseil wird wird zwischen Seilschaftserstem und -letztem aufgeteilt oder bei längeren Gehstrecken im Rucksack verstaut. Wenn bald wieder felsiges oder kombiniertes Gelände wartet, kann es auch über den Körper aufgenommen werden. Beherrscht nur einer der beiden die notwendige Rettungstechnik, verbleibt das Restseil komplett bei dieser einen Person.

Angeseilt im Aufstieg
Außer bei verzwickten Bruchzonen ist der Aufstieg am Seil zu Fuss (und auch mit Skiern) recht gut machbar, wenn folgende Punkte beachtet werden:
Das Seil immer so „gespannt“ halten, dass es allenfalls leicht den Schnee berührt. Das verlangt ganz einfach Disziplin und das Einhalten der Abstände!
Scharfe Richtungsänderungen auf ein Minimum reduzieren und das Gelände vorausschauend nutzen.
Der Seilschaftserste gibt das Tempo vor, wobei sich dieses am Konditionsschwächsten orientieren muss. Damit das Seil immer entsprechend „gespannt“ bleibt, müssen sich alle Seilschaftsmitglieder strikt und kontinuierlich diesem Tempo anpassen.
Gleichmäßige Steigungen fördern ein gutes durchgehendes Tempo. Bei einer Verflachung darf nicht vergessen werden, dass sich die hinteren Mitglieder der Seilschaft immer noch in steilerem Gelände befinden könnten.

Angeseilt in der Abfahrt
Zu Fuß ist der Abstieg als Gletscherseilschaft recht problemlos und niemand wird sich grossartig dagegen wehren. Im Gegenteil, das Gewicht des Seils kann über die ganze Seilschaft aufgeteilt werden, und entspannt dem Seilersten in gemütlichem Tempo hinterherzulatschen, ist oft eine feine Sache. Was beim Abstieg von der Reihenfolge berücksichtigt werden muss: Geht es steiler abwärts, ist das Halten eines Spaltensturzes schwieriger, da einem der Sturzzug mit hinunter Richtung Spalte zieht – das Halten wird also schwieriger. Deswegen gehen abwärts leichtere Personen vor, damit die schwereren dahinter deren Sturz leichter halten können. Ernste Spaltenstürze passieren selten und wenn eine ganze Seilschaft verschwindet, dann oft, weil diese nur aus 2 Personen besteht, die schwerere vorangeht, in eine tiefe Spalte stürzt und die leichte Zweite mitreißt.
Anders mit Skiern: Die Skiabfahrt am Seil mag wirklich niemand. Mit etwas Training ist sie aber durchaus machbar. Allerdings nur für solide Skifahrer! Ein schlechter Skifahrer kann bei einer solchen Aktion nämlich schnell zur Nervenbelastung für alle Beteiligten werden. Deswegen wird man mit Skiern nur angeseilt abfahren, wenn man muss, d.h. wenn es der Gletscher verlangt. Zur Technik des Abfahren mit Skiern am Seil:
Die Abstände eventuell etwas vergrößern und gleichmäßig weite Radien fahren.
Die Geschwindigkeit konstant langsam halten, Bögen idealerweise mittels Stemmschwung nehmen, dazwischen Schrägfahrten anstreben.
Die Schrägfahrten bewusst flach anlegen – die Spur wird nämlich immer schneller.
Auch bei der Abfahrt sollte das Seil möglichst gespannt bleiben – das heißt: Konsequent Abstände einhalten.
Nur der Seilschaftserste hält die Stöcke in der Hand, alle anderen verstauen sie sicher am Rucksack und halten das Seil zum Vordermann in den Händen, um den Abstand regulieren zu können. Achtung: Seil nicht um die Hand/Finger wickeln!
Der schlechteste Skifahrer fährt entweder voraus (bei offensichtlichem Routenverlauf) oder an letzter Position, wo er die „beste“ Spur hat.
Hinweis: Egal ob in Aufstieg oder Abstieg bzw. Abfahrt. Nicht nur im Winter, auch im Sommer gilt es nach Neuschneefällen die Lawinengefahr zu beurteilen. Angeseilt von einer Lawine erfasst zu werden, ist ein Worst Case, der verhindert werden muss. Apropos: Auch bei einer Ganzkörperverschüttung ist es egal, welche Jahreszeit gerade herrscht, die entsprechende Notfallausrüstung (LVS, Schaufel, Sonde) sollte dabei sein. Aber das ist ein anderes Thema, nur wenn für die Hochtourenwoche im Juli über 3.000 m Neuschnee und Wind gemeldet sind …

Skihochtour: 8 Standardmaßnahmen am Gletscher

Seil- und Sicherungstechnik: Knotenkunde

Wintersport im freien Gelände: Alles was du wissen musst
 Berg & Freizeit
Berg & FreizeitDas totale Jetzt
 Werbung
Werbung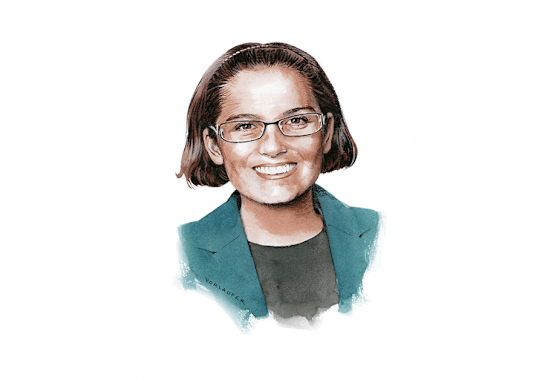 Berg & Freizeit
Berg & FreizeitDas Büro in den Wolken
 Berg & Freizeit
Berg & FreizeitExpedition Bolivien: In 3 Schritten zur mentalen Stärke
 Berg & Freizeit
Berg & FreizeitLAB ROCK Kapitel 3: In der Wand